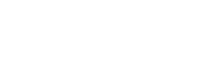Am Standort der Kirche San Fiz de Solovio befand sich einst die Einsiedelei des Eremiten Paio
Von den ersten Pilgern bis heute
Der Eremit Paio entdeckt das Grab im Jahrzehnt um 820
Um das Jahr 820 ereignete sich in Galicien die Entdeckung des Grabes des heiligen Apostels Jakobus und infolge davon die sofortige Einrichtung des „locus Sancti Iacobi”, eines heiligen Ortes für die Verehrung der sterblichen Überreste des Heiligen.

Zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt im Jahrzehnt zwischen 820 und 830 wurde das Grab von Jakobus des Älteren entdeckt. Im Nordwesten der spanischen Halbinsel regierte im Königreich Asturien König Alfons II. Er gilt als der erste große Verfechter des Heiligen. Der König war im Kloster Samos erzogen worden und nahm mit großem Interesse die ihm vom Bischof Teodomiro von Iria überbrachte Nachricht entgegen.
Der Eremit Paio beobachtete mehrere Nächte lang ein wundersames Leuchten über dem Wald Libredón und benachrichtigte den Bischof Teodomiro de Iria davon
Ein Eremit mit Namen Paio entdeckte in der Nähe der Ortschaft Solovio, in der heute die Kirche San Fiz de Solovio steht, im Wald Libredón die Reste einer einfachen Grabstätte. Dort befand sich das heute als das des Apostels Jakobus des Älteren sowie seiner Jünger, Teodoro und Atanasio, bekannte Grab.
Auf diesem Fund gründet eine stark verwurzelte volkstümliche Überlieferung, die zuvor schon von den Glaubensbrüdern Beda el Venerable und Beato de Liébana dokumentiert worden war. Bis dahin fehlten jedoch Beweise. König Alfons II. machte sich sofort zu einer Besichtigung des Ortes auf und befahl den Bau einer schlichten Kirche, die schließlich im Jahr 899 von König Alfons III. errichtet wurde. Beide Bauwerke waren die Vorläufer der heutigen Kathedrale und der Stadt Santiago.
Könige, Äbte und Mönche – die ersten Pilger im 9. und 10. Jahrhundert
Monarchen aus Asturien, Äbte und französische und deutsche Mönche sind die ersten Pilger, die ab dem ausklingenden 9. Jahrhundert nach Santiago aufbrachen.

Die asturischen Herrscher Alfons II. und Alfons III. sind gemeinsam mit dem Hof von Oviedo die ersten bekannten Pilger des 9. Jahrhunderts. Alfons III. der Große machte sich im Jahr 872 auf Pilgerfahrt und kehrte zwei Jahre später, im Jahr 874, mit Königin Jimena zurück. Er hatte dem Apostel ein goldenes Kreuz mit Edelsteinen, das Symbol des Königreichs Asturien, gespendet.
Die asturischen Könige Alfons II. und Alfons III. sind gemeinsam mit dem Hof von Oviedo die ersten bekannten Pilger im 9. Jahrhundert
Im 10. Jahrhundert trafen die ersten europäischen Pilger ein, unter ihnen befand sich im Jahr 930 Bretenaldo, ein Franke, der beschloss, sich im ursprünglichen Ort Compostela nieder zu lassen. König Ramiro II. pilgerte zwei Jahre - bis 932 - hierher. Der berühmteste Pilger im 10. Jahrhundert war jedoch Bischof Gotescalco aus Le Puy. Er reiste am Ende des Jahres 950 in Begleitung anderer Kleriker und einer Gruppe Getreuer aus Aquitanien nach Compostela.
Kurze Zeit später, im Jahr 959, nimmt der Abt Cesáreo aus dem katalanischen Kloster Santa Cecilia de Montserrat die Pilgerfahrt zum heiligen Ort auf. Er bat die Kirche in Compostela um Unterstützung bei seinem Wunsch an den Papst, den Bischofsitz in Tarragona wieder einzurichten. Durch dieses Fürspracheanliegen erhielt der Apostolische Stuhl im Königreich León größeres Gewicht und die Stellung Compostelas als prestigeträchtiger Sitz im Westen der Halbinsel wurde gestärkt.
Das goldene Zeitalter der Pilgerfahrten (11. - 13. Jahrhundert)
Frankreich, Italien, Mittel- und Osteuropa, England, Deutschland, sogar Island und natürlich auch ganz Hispanien kamen zu Fuß, mit dem Pferd oder mit dem Schiff

Santiago erweist sich schnell, vom 11. bis 13. Jahrhundert, als internationaler Anziehungspunkt für Pilgerfahrten dank der Verbindung von Kräften und Interessen, die zu Gunsten Compostelas von den wichtigsten Machtzentren im Westen, der Krone, von Alfons II. bis Alfons VII. und Sancho Ramírez, dem Papsttum, Calixt II. und Alexander III., sowie den Klöstern in Cluny und den Zisterziensern unternommen wurden. Auf diese Weise schrieb der Jakobsweg seine tausendjährige Geschichte.
Ferner soll auch im Jahr 1214 eine Pilgerfahrt des Heiligen Franz von Assisi zum Grab des Apostels stattgefunden haben
Das goldene Zeitalter der Pilgerfahrten fand in diesen Jahrhunderten statt. Die Pilger kamen aus Frankreich, Italien, Mittel- und Osteuropa, England, Deutschland und sogar aus Island und natürlich aus ganz Hispania zu Fuß, mit dem Pferd und dem Schiff. Sie wurden hauptsächlich in einem Herbergsnetz unter der Schirmherrschaft von Königen, Adligen und Bürgern der Städte, vor allem in den Stadtvierteln, in denen Franken lebten, und von den Mönchen aus dem Orden von Cluny aufgenommen und in Klöstern untergebracht.
Ferner soll auch im Jahr 1214 eine Pilgerfahrt des Heiligen Franz von Assisi zum Grab des Apostels stattgefunden haben. Durch dieses Ereignis wurde eines der fruchtbarsten Kapitel des Jakobsweges eingeleitet, die Erneuerung der abendländischen Spiritualität durch die erzieherische, evangelisierende und brüderliche Arbeit der Franziskanermönche. In Santiago gründeten sie das erste Kloster dieses Ordens.
Die Gastfreundschaft – ein Wesensmerkmal des Jakobswegs
Seit dem Mittelalter besteht einer der wesentlichen Aspekte beim Erlebnis einer Pilgerfahrt in der Aufnahme des Pilgers.

Seit dem Mittelalter besteht einer der wesentlichen Aspekte beim Erlebnis einer Pilgerfahrt in der Aufnahme des Pilgers. Von den verschiedenen Einrichtungen - von der Krone und der Kirche bis zum Volk - wurde eine ständige sanitäre und spirituelle Unterstützung gewährleistet. Dabei war die Gründung von Herbergen für die Bereitstellung spiritueller, materieller und sanitärer Leistungen für eine ständig wachsende Pilgerzahl, die sich auf dem Weg nach Santiago befand, ausschlaggebend.
Seit den ersten Pilgerfahrten wurde von der Krone, der Kirche und von der Bevölkerung eine ständige sanitäre und spirituelle Unterstützung gewährleistet
Die meisten Aufnahmeeinrichtungen für Pilger und Arme wurden mittels Spenden von Religionsgemeinschaften, Bischofssitzen, Adelsfamilien, ranghohen Klerikern und vor allem von Königshäusern finanziert. Die Herrscher gegründeten eine große Anzahl Herbergen auf dem Pilgerweg und zeigten damit den Wunsch der Krone zur Ausübung der christlichen Tugend der Nächstenliebe und ferner Gott und dem Heiligen Jakobus als Schutzpatron des Königreichs zu dienen. In den kleinen Herbergen des Mittelalters war es Brauch, Räume mit zwölf Betten bzw. sechs Doppelbetten in Anlehnung an die zwölf Apostel Jesu anzubieten.
In der Vorstellung eines Menschen aus dem Mittelalter war ein Pilger ein von Gott Gesandter. Deshalb musste er so respektiert und behandelt werden, als wäre er Jesus Christus selbst. Es war daher nicht unüblich, in verschiedenen Szenen den auferstandenen Jesus unter den Jüngern in Emmaus als Retter in Pilgerkleidung mit den typischen Pilgersymbolen, dem Pilgerbündel und der Jakobsmuschel abzubilden. Die bekannteste dieser Darstellungen befindet sich auf dem romanischen Relief des Klosters Santo Domingo de Silos, in Burgos.
Das späte Mittelalter (14. und 15. Jh.)
Der Jakobsweg hielt in dieser Zeit langen Hungersnöten, wirtschaftlichen und philosophischen Krisen stand.

Die Geschichte des Jakobswegs verläuft parallel zu den Wechselfällen der europäischen Geschichte. Trotz der negativen Einflüsse auf das Leben und die Kultur, die durch Ereignisse wie den Hundertjährigen Krieg (1337-1453), die Pest (1348) und lang anhaltende Hungersnöte, wirtschaftliche und philosophische Krisen ausgelöst wurden, überdauerte der Jakobsweg das harte 13. Jahrhundert und das etwas günstigere 15. Jahrhundert.
Im ausklingenden 14. Jahrhundert entwickelte sich in den Küstengebieten Galiciens, mit dem Hafen von A Coruña als Referenz, ein reger Handel mit den am Atlantik gelegenen Ländern Europas mit einträglichen Ergebnissen
Bei den Feierlichkeiten zum römischen Heiligen Jahr im Jahr 1300 bot der Papst den Pilgern den vollkommenen Ablaß, d. h. einen vollständigen Erlass aller Sünden an. Im ausklingenden 14. Jahrhundert nahm ein wirtschaftlicher Aufschwung seinen Anfang, der sich im folgenden Jahrhundert vollständig entwickelte. Vor dem Hintergrund von Krise, Chaos und Stabilisierung traten Bauern, Bürger, Soldaten, Edelleute und Ordensbrüder - vor allem in Zeiten der Waffenruhe - eine Pilgerschaft aus dem Verständnis des Kosmos, in dem die Milchstraße als ein Weg für die Seelen ins Paradies ausgelegt wurde, auf.
Die Suche nach der Herrlichkeit verführte sowohl den einfachen Menschen als auch den Ritter. König Alfons XI. von Kastilien(1325-1350) wird in Compostela zum Ritter geschlagen, Doña Isabel von Aragón (ca. 1270-1336), die Witwe des portugiesischen Königs Dinís, pilgert 1325 und spendet unter anderen Besitztümern und persönlichen Reichtümern auch ihre Krone. Zu Beginn des Jahres 1343 erreichte die Heilige Birgitta von Schweden (1303-1373) die Stadt Compostela, zu der sie u. a. in Begleitung ihres Ehemanns, Ulf Gudmarsson, gepilgert war. In der Kathedrale empfing sie eine ihrer mystischen Visionen.
Im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts entwickelte sich in den Küstengebieten Galiciens ein reger Handel mit den am Atlantik gelegenen Ländern Europas mit einträglichen Ergebnissen. Durch die Krisensituation, unter der Frankreich, Flandern, England und andere Länder litten, wurde in Galicien ein internationaler, eng mit den Pilgerfahrten verbundener Handel auf dem Seeweg angestoßen, von dem A Coruña, als Referenz unter den Pilgerhäfen profitierte.
Im Hafen von La Coruña landeten in den Jahrzehnten des ausklingenden 14. Jahrhunderts und während des 15. Jahrhunderts zahlreiche Schiffe mit Pilgern aus Flandern, der Bretagne, England und den Balkanländern sowie Waren aus den Niederlanden, Andalusien, Katalonien, Genua und Venedig an. An den Hafenkais wurde Räucherfisch übers Mittelmeer und Ribeiro-Wein in die Regionen an der Atlantikküste Europas exportiert.
Die Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg in der Moderne (16. – 18. Jh.)
Die Reformation und die Religionskriege auf deutschem Boden und in Frankreich verminderten den Zustrom an Pilgern zum Jakobsweg.

Im 16. Jahrhundert erlebt der Jakobsweg eine tiefe Krise, für die es mehrere Ursachen gab. Zunächst übte die von Erasmus von Rotterdam über Pilgerfahrten geäußerte ironische Kritik einen negativen Einfluss auf die Empfindsamkeit der humanistischen Intellektuellen aus. Die Kritik wurde noch durch Martin Luther verstärkt. Die Reformation und die Religionskriege auf deutschem Boden und in Frankreich verminderten den Zustrom an Pilgern zum Jakobsweg. Mit dem offenen Krieg zwischen dem kaiserlichen Spanien von Karl V. und Frankreich blieb diese Auseinandersetzung weiterhin bestehen und sah sich sogar noch in der Epoche von Philipp II. mit dem Schließen der Grenzen, um den Zustrom von protestantischem Gedankengut in das Königreich zu verhindern, verstärkt.
Im Mai des Jahres 1589 befahl der Erzbischof Juan de Sanclemente aus Furcht vor einem Angriff auf Compostela durch die Engländer mit Sir Francis Drake, von dessen Schiffe A Coruña beschossen wurde, die Gebeine des Apostels im Presbyterium der Kathedrale zu verbergen
Im 16. Jahrhundert stellte auch die Inquisition eine Schwierigkeit dar, da Ausländer grundsätzlich unter Generalverdacht standen, einschließlich der Jakobspilger, von denen einige der Spionage angeklagt wurden. Nach dem Konzil von Trient (1545-1563) rüstete die katholische Kirche mit der Glorifizierung des Marien- und des Heiligenkults ideologischen auf.
Im Mai des Jahres 1589 befahl der Erzbischof Juan de Sanclemente aus Furcht vor einem Angriff auf Compostela durch die Engländer mit Sir Francis Drake, von dessen Schiffe A Coruña beschossen wurde, die Gebeine des Apostels im Presbyterium der Kathedrale zu verbergen. Die genaue Stelle blieb mehrere Jahrhunderte unbekannt bis 1879, dem Jahr der zweiten Entdeckung der sterblichen Überreste des Apostels.
Durch die sich im Geist der Gegenreformation erneut wandelnde Religiosität des Barocks wurde die Wiederaufnahme des Jakobswegs im 17. Jahrhundert begünstigt - vor allem in den Heiligen Jahren. Dennoch wanderten auf dem Weg falsche Pilger unter Jakobspilgern, die lediglich von der Nächstenliebe und von Spenden in Dörfern und Städten profitieren wollten. Aufgrund der französischen Revolution 1789 und des Krieges zwischen mehreren europäischen Mächten und Frankreich kam es zum Ende des 18. Jahrhunderts erneut zu einem Rückgang der Pilgerzahlen.
Der Jakobsweg im 19. und 20. Jahrhundert
Die zweite Entdeckung der Reliquien des Apostels im Jahr 1879 kennzeichnete die Rückgewinnung eines Pilgerweges, der im 20. Jahrhundert durch die Geißel des spanischen Bürgerkriegs und des Weltkrieges bedingt sein würde.

Die Flamme der Pilgerfahrten wurde einige Jahrzehnte lang mit dem geringen Zulauf von Spaniern und Portugiesen am Leben gehalten. Dies betraf auch die Heiligen Jahre. Die Umkehr zeichnete sich ab der zweiten Entdeckung des Körpers des Heiligen Jakobus im Jahr 1879 mit der päpstlichen Erklärung über den Fund der sterblichen Überreste des Apostels ab. Die schriftliche Bestätigung erfolgte zunächst in der Bulle Deus Omnipotens (1884) und 1885 mit der Abhaltung eines außerordentlichen Heiligen Jahres.
In den 1950er und 1960er Jahren zeigten sich schwache Anzeichen der Erholung mit der Gründung des ersten Verbandes der Jakobuspilger in Paris 1950 und in Estella im Jahr 1963 sowie den Feiern der Heiligen Jahre 1965 und 1971
Der Jakobsweg verzeichnete einen neuen Aufschwung in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor allem dank des pastoralen Einsatzes der Erzbischöfe Payá und Martín de Herrera. Der von 1936 bis 1939 dauernde spanische Bürgerkrieg entzweite eine Gesellschaft, die lange Zeit brauchen würde, um wieder den Impuls für Pilgerreisen in Europa zu erhalten, das sich in zwei Weltkriegen und dem nachfolgenden kalten Krieg befand .
In den 1950er und 1960er Jahren zeigten sich schwache Anzeichen der Erholung mit der Gründung des ersten Verbandes der Jakobuspilger in Paris 1950 und in Estella im Jahr 1963 sowie den Feiern der Heiligen Jahre 1965 und 1971. Der endgültige Anstoß ereignete sich im Jahr 1982 mit der Pilgerreise von Papst Johannes Paul II. und seiner Europarede am Hochaltar der Kathedrale von Santiago.
Der Jakobsweg heute
In einer globalisierten Welt ist das Erlebnis einer Pilgerreise nach Santiago einzigartig.

Die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts sind gekennzeichnet durch ein globales Verständnis von Denken und Wirtschaft, von der Entwicklung der digitalen Technologie im Dienste der Kommunikation, von Kultur und Unterhaltung, der Bedrohung durch Terroranschläge von Islamisten – die Attentate am 11. September 2001 in New York und Washington prägen den Beginn des Jahrhunderts – , durch eine wachsende Sorge um die Umwelt und vom Ausbruch einer weltweiten Wirtschaftskrise im Jahr 2008, die zur Verschärfung der sozialen Lage führte.
Zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts und gleichzeitig eines neuen Jahrtausends ist die Pilgerreise auf dem Jakobsweg mehr als nie zuvor ein übergreifendes Phänomen, einerseits spirituell und ökumenisch, aber auch offen für andere Menschen, Freundschaft und gegenseitiges Verständnis
In Anbetracht dieser Verunsicherungen und auf der Suche nach neuen bereichernden Erfahrungen wird durch die traditionelle Pilgerreise nach Santiago eine radikale Verhaltensänderungen, eine Alternative menschlicher und universeller Werte in einer immer stärker globalisierten, und auch entfremdenden und wettbewerbsorientierten Welt vorgeschlagen.
Zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts und gleichzeitig eines neuen Jahrtausends ist die Pilgerreise auf dem Jakobsweg mehr als nie zuvor ein übergreifendes Phänomen, einerseits spirituell und ökumenisch, aber auch offen für andere Menschen, Freundschaft und gegenseitiges Verständnis. Ein Weg, auf dem die Pilger neben dem Erleben von Natur und Geschichte auch eine gemeinsame Kultur und Solidarität erfahren.
Der Pilger erlebt heute einen Raum, der jahrhundertelang als heilig galt - den Jakobsweg. Er erstreckt sich über eine geheiligte Geographie, die gleichzeitig auch historisch und kulturellen ist. Letzten Endes handelt es sich um eine ganz neue Form der Pilgerreise, bei der die Tradition nicht verleugnet wird, sondern ihr vielmehr die Wünsche und Motivierungen der zeitgenössischen Gesellschaften hinzugefügt werden.